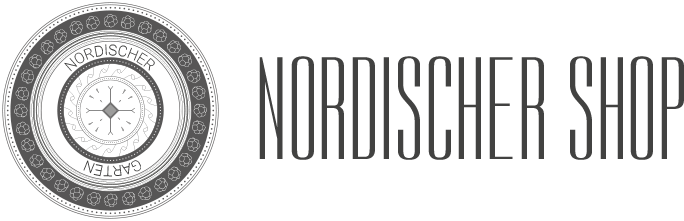Deutscher Name: Pfaffenhütchen,
Synonyme: Pfaffenkäppchen, Rotkehlchenbrot, Gewöhnlicher Spindelstrauch
Botanisch: Euonymus europaeus
Familie: Spindelbaumgewächse
heimisch
Größe: 2-3/4 (6) m hoch und 2,5-4 (5) m breit
Wuchs: Aufrechter Strauch, im Alter sich ausbreitend und gerne überhängend, sparrig
Blüte: gelb-grün, klein, unscheinbar, Blüten bilden aber reichlich Nektar
Blütezeit: Mai-Juni
Pollen- / Nektarwert: P1/N2
Frucht: Sehr zierend, hoch attraktiv. Rosarot bis kaminrote vierlappige Fruchtkapsel. Der leuchtend orangefarbene Samenmantel enthält bis zu vier Samen.
Die eigentlich weißen, eiförmigen Samen sind vom einer dünnen, leuchtend orangefarbenen Haut, dem Arillus umhüllt. Reift die Kapsel, platz sie auf und gibt die stark giftigen Samen frei, welche an verlängerten Stielchen aus der nun geöffneten Kapsel baumeln.
Reifezeit: August-Oktober
Blatt: eiförmig bis elliptisch, 6-8 cm lang, dunkelgrün, giftig
Herbstfarbe: sehr prächtig; ein oftmals leuchtendes Feuerwerk aus Rot- und Orange-Tönen
Zweige/Rinde: Die recht typischen Zweige sind 4kantig oder gerieft, meist grün, glatt aber auch typischerweise mit schwach ausgeprägten Korkleisten besetzt.
Wurzel: Ein besonders dichtes und feines Wurzelwerk durchzieht den Boden. Unterwuchs kommt schwer auf.
Aus dem flach wachsenden, dichtfilzigen Wurzelwerk treibt das Rotkehlchenbrot mal mehr mal weniger zahlreiche Ausläufer
Wuchs: aufrechter Strauch, auch kleines Bäumchen, oftmals etwas sparrig. Ohne Pflegemaßnahmen bildet es besonders für die Tierwelt wertvolle Dickichte aus
Lebensraum, Standort: Anspruchslos, alle mäßig trockenen bis feuchte Böden. Sonnig bis halbschattig, extrem anpassungsfähig. Sehr frosthart und hitzetolerant. In lichten Laubwäldern, im Auwald, an Waldrändern aller Art sowie in Trockengebüschen.
Boden: Eigentlich sind alle kultivierten Böden gut geeignet, solange sie nicht ganz zu trocken sind. Neutral bis sogar stark alkalisch. Bevorzugt werden frisch-feuchte, nährstoffreiche Standorte, auch schwere Ton- und Lehmböden.
Auf etwas trockeneren Böden blüht er reicher, auf feuchten Böden wächst er rascher.
Schön als Einzelpflanze aber auch bestens in Wildsträucherhecken zu integrieren. Von der Größe her auch ideal für den kleineren Garten
Standort: sonnig bis halbschattig
Vorkommen: Ganz Europa und darüber hinaus
Eigenschaften: Äußerst frosthart und sehr windfest. In sehr windigen Gegenden werden die Blätter sogar etwas ledrig, um gegen austrocknende Winde besser gerüstet zu sein. Auch Hitze und sommerliche Dürreperioden können ihm mal eingewurzelt nichts anhaben. Auch Überschwemmungen werden gleichgültig hingenommen.
Reichlich Nektarbildung und daher reger Insektenbesuch an den leicht zugänglichen Scheibenblüten.
Wichtige Nahrungspflanze für Schwebfliegen, Honigbienen, div. Käferarten, einer Sandbienenart und auch Ameisen.
Schmetterlinge: Die Pflanze wird nach dem Laubaustrieb gerne von Pfaffenhütchen-Gespinnstmotten angenommen. Diese spinnen oft die gesamte Pflanze in ein seidiges Gespinst ein. Die Pflanzen treiben in der Regel nach dem Verschwinden der Raupen wieder unbeschadet durch. Sehr ähnliches kann bie der Traubenkirschen-Gespinnstmotte beobachtet werden.
Auch der Pfaffenhütchen-Schmalzünsler nutzt die Pflanze als Raupenfutterpflanze.
Wichtige Vogelnahrungspflanze: Im Herbst und Winter werden die Früchte von zahlreichen Vögeln wie Drosseln oder Rotkehlchen und Elstern gerne als energiereiche Nahrungsquelle genutzt. Daher der Spitzname Rotkehlchenbrot. Die Früchte des Pfaffenhütchens werden von mindestens 24 heimischen Vogelarten als Nahrungsquelle genutzt.
Tipps & Wissenswertes
Das Pfaffenhütchen ist einer unserer häufigsten heimischen Sträucher. Aus seinem zähen Holz wurden früher Orgelpfeifen, Schuhnägel und Stricknadeln hergestellt.
Aus der Wurzel wurde ein Milchsaft von kautschukähnlicher Substanz hergestellt. Dieser galt als bester Nichtleiter in elektrischen Anlagen (Kabelisolierungen), ist heute aber nicht mehr im Gebrauch.
Der Same keimt erst nach einer Samenruhe von 3-4 Jahren.
Der Name Pfaffenhütchen ist an die Form der Kapselfrucht angelehnt, welche dem Birett, der Kopfbedeckung katholischer Geistlicher ähnelt.
Aus den vermahlenen Samen wurde früher eine Art Insektenpulver hergestellt. Als Shampoo oder in Salben sollte das Pulver sogar die von Milben verursachte Krätze heilen.
Doch für den Menschen ist das Pfaffenkäppchen beim Verzehr eine Giftpflanze. Der Genuss der Früchte kann zu Kreislaufstörungen, Fieber und Koliken führen. Die Giftwirkung tritt erst nach wenigstens zwölf Stunden auf. In Extremfällen kann es beim Verzehr von 30 bis 40 Samen zu tödlichen Lähmungen kommen.
Eine Haftung hinsichtlich der Verwendung ist ausgeschlossen.
Quellen:
Wikipedia