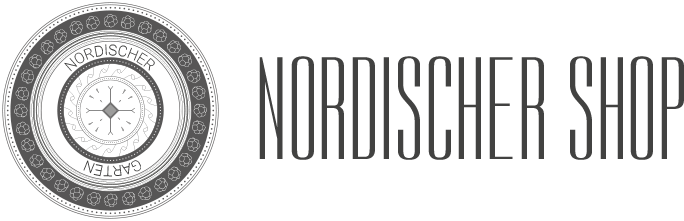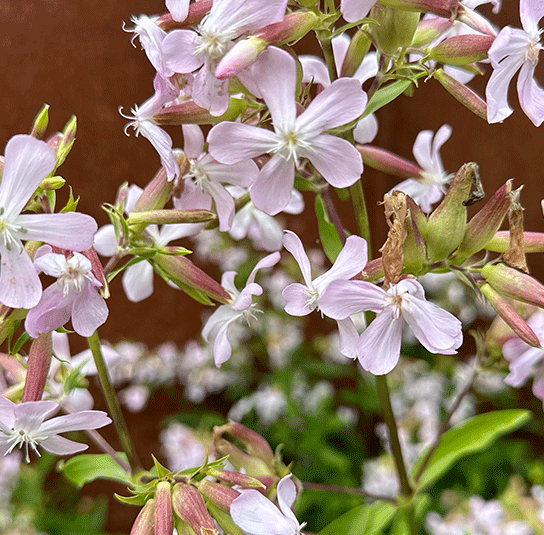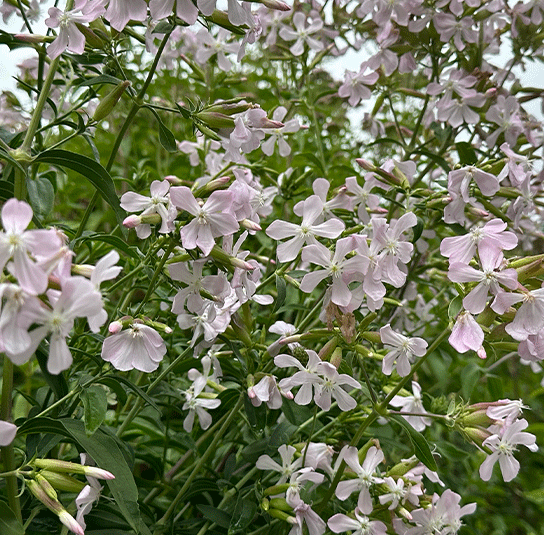Deutscher Name: Echtes Seifenkraut
Synonyme: Seifenwurz, Waschwurz
Botanisch: Saponaria officinalis
Familie: Nelkengewächse
fein duftende Nachtfalterpflanze
uralte Waschpflanze
gedeiht auch in höheren Wiesen
Höhe: 30 bis 80 cm
Blütezeit: Juni – Oktober
Blüte: rosa, zartrosa, seltener weiß, fünfzählige Blütenstände, angenehmer, feiner Duft.
Der Blütenduft ist besonders abends und nachts sehr gut wahrnehmbar.
Frucht/Samen: Fruchtreife von September – Oktober; trockene Kapselfrüchte mit zahlreichen, schwarzen, rundlichen Samen
Wuchs: aufrecht, sich durch verzweigende Ausläufer kontinuierlich im Bestand erweiternd und entweder locker rasige , Bestände bildend oder auch kompaktere Horste ausbildend. In wiesenartigen Situationen kann es sich schön einweben um da und dort aufzutauchen, ohne jedoch die ganze Wiese zu übernehmen. Das nicht immer ganz standfeste Seifenkraut ist dankbar über eine gewisse Anlehnmöglichkeit an nahe Stauden- oder Gräsernachbarn. Je schattiger der Standort, umso mehr verliert es an Standfestigkeit.
Wurzel: kriechend, sich zu fingerdicken Rhizomen entwickelnd. Die Hauptwurzel kann rübenartig verdickt sein.
Lebensraum, Standort: geschätzt werden nährstoffreiche, meist frische Kies- oder Sandböden. Doch selbst auf Kiesbänken von Gleisanlagen, auf Brachen, in Unkrautfluren, entlang von Wegen, an Dämmen als auch in Au-Landschaften und an Flussufern ist es anzutreffen. Es ist also extrem anpassungsfähig und durch sein kriechendes Rhizom = verdickte Wurzel, breitet es sich mit den Jahren kontinuierlich aus. Somit ist stets für Seifennachschub gesorgt (Siehe Verwendung). Vollsonnig bis leicht absonnig.
Besonders Nachtfalter lieben das Seifenkraut.
Um Nachtfalter durch den Duft des Seifenkrautes anzulocken, sind größere Bestände besonders wirkungsvoll. Mehrere Quadratmeter verströmen natürlich eine kräftige Portion Abendduft. Dieser Duft, der gen Abend an Intensität deutlich zulegt, wird weit in die Landschaft getragen und kann so besonders von den extrem gut riechenden Nachtfaltern auch auf weite Distanz gut wahrgenommen werden. Alsbald werden die Blüte als zuverlässige Nachtbar angesteuert.
Kleiner Weinschwärmer, Mittlerer Weinschwärmer, Silberbaltt-Goldeule, Grauer Mönch, Fledermausschwärmer, Kiefernschwärmer und weitere laben sich am Nektarangebot. Neben dem Nektar versorgt das Seifenkraut auch etliche Schmetterlingsraupen mit Nahrung. Die Eier werden also am Seifenkraut abgelegt und die Raupen fressen am Seifenkraut.
Auch Wildbienen, Schwebfliegen und andere Insektenarten schätzen das unkomplizierte Gewächs. Immerhin konnten bisher etwa 12 Wildbienenarten am Seifenkraut nachgewiesen werden.
Verwendung im Garten: wunderbare Lockpflanze für Nachtfalter aber auch ökologisch besonders wertvoll, da man es zur Seifenherstellung heranziehen kann. Sehr natürlich wirkt das Seifenkraut in mehr oder weniger blumenreichen Wiesen. Da es sehr anpassungsfähig ist, kann es gerade in wenig beachteten Randbereichen eine große Aufwertung sein.
Die tatsächliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Seifenkrauts hängt stark vom jeweiligen Boden und der verfügbaren Feuchtigkeit ab. In locker sandigen Böden kann sich die Wurzel rascher ausbreiten als in sehr schweren, fest-lehmigen Böden.
Vorkommen: Europas, Sibirien, Westasien, Kaukasusraum
In Mitteleuropa meist bis in Höhenlagen von etwa 700 Metern. In Baden-Württemberg steigt die Art aber bei Fischbach (Schluchsee) bis auf etwa 1000 Meter Seehöhe auf.
Kombination: am besten mit ebenfalls kräftigen mehrjährigen Stauden ähnlicher Höhe sowie auch niedrigere Stauden aus Wiesenverbänden wie Kriechender Günsel,
Als SEHR alte Kulturpflanze sollte das Seifenkraut in keinem Bauern- oder großzügigem Nutzgarten fehlen. Im Naturgarten ist die Verwendung sowieso fast verpflichtend 🙂
WASCHEN: Mit dem Seifenkraut kann vorzüglich gewaschen werden (Pflanzenname).
Das Gewöhnliche Seifenkraut ist ein Kulturbegleiter und wurde vermutlich seit der Jungsteinzeit kultiviert. Die Wurzeln wurden bis weit ins 19. Jahrhundert als Seifenersatz verwendet. Deshalb wurde das Gewöhnliche Seifenkraut auch in Europa noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts angebaut. In der Slowakei werden noch heute Wäschestücke mit angeschnittenen Rhizomstückchen eingeseift.
Umweltbewusste Betriebe und Privatpersonen verwenden heute Seifenkrautlösung beispielsweise zur Teppich- und Polsterreinigung.
ANWENDEN: Aufgrund des hohen Anteils an Seifenstoffen können die getrockneten Wurzelstücke als Tee aufgegossen bei Schleimhautentzündungen der oberen Atemwege eingesetzt wird. Früher wurde der getrocknete, zerriebene Wurzelstock auch als Schnupftaback eingesetzt.
Gabriele Nedoma, Natruwaschmittel aus Wald und Wiese, Servus Verlag
zum Buch: https://amzn.to/3OlpgzG
VORSICHT: Im Handel wir leider fast immer die gefüllte Form angeboten. Nicht immer korrekt ausgewiesen als gefüllte Form. In der Sortenbezeichnung steht dann ´Plena` für gefüllt (Saponaria officinalis ´Plena`) Doch auch am Naturstandort bei sicher wilden Formen gibt es eine gewisse Neigung zur Ausbildung gefüllter Blüten, die man selten beobachten kann.
Wissenswertes:
In Restauratorenwerkstätten wird auch heute noch Seifenkrautlösung zur Reinigung von historischen Textilien und Möbelstücken verwendet.
TIPP: werden die entstehenden Samenstände entfernt, bildet sich meist rasch ein neuer Blütenflor – so kann die Blüte bis in den Herbst verlängert werden
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnliches_Seifenkraut
Hinweis zu medizinischen Inhalten und Wirkungsweisen:
Die hier vorgestellten Inhalte geben lediglich einen Überblick über die medizinische Nutzung. Sie stellen keine Empfehlung zur Anwendung dar. Bitte suchen Sie daher immer das Gespräch mit einem Arzt oder Apotheker.
Alle Angaben zu Verwendung, Kulinarik oder vermuteter Heilwirkung gelten ohne Gewähr. Die Angaben dazu haben lediglich informativen Charakter und sollen den Leser keinesfalls zur Selbstmedikation anregen, sondern einen Überblick über den momentanen Wissensstand geben.
Eine Haftung hinsichtlich der Verwendung ist ausgeschlossen.